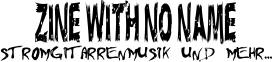

„Die Zukunft war früher auch besser.“
(Karl Valentin)
 Wenn heute von dem 1974 im Alter von gerade einmal 26
Jahren verstorbenen Folkmusiker Nick Drake die Rede ist, dann zumeist
im Tonfall großer Ehrerbietung. Nur drei Alben veröffentlichte der
labile und in seinen letzten Jahren an Depressionen erkrankte Musiker,
die zu ihrer Entstehungszeit keineswegs erfolgreich waren und erst
Jahrzehnte nach seinem Tod von einer breiteren Hörerschaft
wiederentdeckt wurden – mitverantwortlich dafür ausgerechnet ein
Werbespot, der einen Auszug aus einem Drake-Song nutzte. Die Frage, ob
Nick Drake in klarer Suizidabsicht starb oder es sich eher um eine Art
Unfall durch falsch dosierte Medikamente und begleitend dazu
konsumierte Drogen handelte, beschäftigt Fans bis heute und führte über
die Jahre zu detailreichen Spekulationen, die aber an den Tatsachen
nichts ändern und abschließend ohnehin nichts zu klären vermögen.
Wenn heute von dem 1974 im Alter von gerade einmal 26
Jahren verstorbenen Folkmusiker Nick Drake die Rede ist, dann zumeist
im Tonfall großer Ehrerbietung. Nur drei Alben veröffentlichte der
labile und in seinen letzten Jahren an Depressionen erkrankte Musiker,
die zu ihrer Entstehungszeit keineswegs erfolgreich waren und erst
Jahrzehnte nach seinem Tod von einer breiteren Hörerschaft
wiederentdeckt wurden – mitverantwortlich dafür ausgerechnet ein
Werbespot, der einen Auszug aus einem Drake-Song nutzte. Die Frage, ob
Nick Drake in klarer Suizidabsicht starb oder es sich eher um eine Art
Unfall durch falsch dosierte Medikamente und begleitend dazu
konsumierte Drogen handelte, beschäftigt Fans bis heute und führte über
die Jahre zu detailreichen Spekulationen, die aber an den Tatsachen
nichts ändern und abschließend ohnehin nichts zu klären vermögen.
 Was jedoch unverrückbar Bestand bis heute hat, ist Nick
Drakes musikalisches Werk wie das vorliegende Debütalbum von 1969,
dessen Titel eigentlich auf die Verpackung einer Zigarettenpapiermarke
verweist, die dem Raucher ankündigte, wann nur noch fünf Blättchen
übrig seien. Damit eine doch reichlich spekulative Verbindung zu den
fünf verbleibenden Lebensjahren des Musikers herzustellen – Stichwort
„düstere Vorahnung“ – mag vielleicht pseudomorbidem Chic geschuldet
sein, ist aber ausgesprochener Unsinn. Zumal ein kranker, mit schweren
Problemen behafteter Mensch eine angemessenere Art der Betrachtung
verdient hätte als eine nachträglich an den Haaren herbeigezogene
Zahlenmystik, als wäre ein tragischer Tod mit nur 26 noch nicht
einschneidend genug auch für die Hinterbliebenen und bedürfte deshalb
einer zusätzlichen, die düstere Aura aufwertenden Dimension.
Was jedoch unverrückbar Bestand bis heute hat, ist Nick
Drakes musikalisches Werk wie das vorliegende Debütalbum von 1969,
dessen Titel eigentlich auf die Verpackung einer Zigarettenpapiermarke
verweist, die dem Raucher ankündigte, wann nur noch fünf Blättchen
übrig seien. Damit eine doch reichlich spekulative Verbindung zu den
fünf verbleibenden Lebensjahren des Musikers herzustellen – Stichwort
„düstere Vorahnung“ – mag vielleicht pseudomorbidem Chic geschuldet
sein, ist aber ausgesprochener Unsinn. Zumal ein kranker, mit schweren
Problemen behafteter Mensch eine angemessenere Art der Betrachtung
verdient hätte als eine nachträglich an den Haaren herbeigezogene
Zahlenmystik, als wäre ein tragischer Tod mit nur 26 noch nicht
einschneidend genug auch für die Hinterbliebenen und bedürfte deshalb
einer zusätzlichen, die düstere Aura aufwertenden Dimension.
Faszinierend an „Five Leaves left“ sind die große musikalische Reife
und Klarheit, bedenkt man, dass es sich hier um ein Debütalbum handelt,
dessen Aufnahmen Drake im Sommer 1968 im Alter von nur 20 Jahren
begann. Der Tonfall des gesamten Albums ist durchzogen von großer
Melancholie und dunkler Poesie, ohne jedoch den Hörer mit musikalischer
Dauerdepression niederzuschmettern. Im Gegenteil: Elton John etwa, der
als Studiomusiker an frühen Probeaufnahmen Nick Drakes mitwirkte,
empfand das Album als trostspendend und erkannte in den Songs die
Schönheit einer Musik, die trotz ihres häufig traurigen Charakters auch
aufbauend sein kann.
Das an Höhepunkten nicht arme Erstlingswerk ist musikalisch trotz
seiner sparsamen Instrumentierung interessant gestaltet.
Streicherpassagen und Klavier unterstützen Drakes Stimme und
Gitarrenspiel, ohne den Gesamtsound damit zu überladen. Besonders
eindrucksvoll gelang dies in Songs wie „River Man“, „Day is done“ oder
dem abschließenden „Saturday Sun“, allesamt Juwelen für Tage, an denen
der Stress des Alltags einmal draußen bleiben darf und Innehalten
angesagt ist. Nick Drakes Musik ist allerdings mehr als nur ein
stimmungsvoller Soundtrack, hier war Großes entstanden, das über die
Jahrzehnte lebendig geblieben ist.
- Stefan - 10/2020
 Die Finnen LORD VICAR sind seit ihrer Gründung im Jahr 2007
eine ziemlich beständige Band, bis auf Wechsel auf der
Bassistenposition ist heute immer noch die gleiche Besetzung wie auf
dem Debütalbum aktiv. Sänger Christian Linderson ist gut informierten
Doom-Freunden natürlich bestens bekannt durch frühere Bands wie COUNT
RAVEN oder TERRA FIRMA und natürlich durch sein Gastspiel bei SAINT
VITUS, bei denen er auf dem 1992er Album „C.O.D.“ mitwirkte – ein nach
meinem Geschmack unterschätzter Vitus-Sänger, der zwischen seinen
Kollegen Scott Reagers und Wino historisch betrachtet leider etwas
untergegangen ist.
Die Finnen LORD VICAR sind seit ihrer Gründung im Jahr 2007
eine ziemlich beständige Band, bis auf Wechsel auf der
Bassistenposition ist heute immer noch die gleiche Besetzung wie auf
dem Debütalbum aktiv. Sänger Christian Linderson ist gut informierten
Doom-Freunden natürlich bestens bekannt durch frühere Bands wie COUNT
RAVEN oder TERRA FIRMA und natürlich durch sein Gastspiel bei SAINT
VITUS, bei denen er auf dem 1992er Album „C.O.D.“ mitwirkte – ein nach
meinem Geschmack unterschätzter Vitus-Sänger, der zwischen seinen
Kollegen Scott Reagers und Wino historisch betrachtet leider etwas
untergegangen ist.
Es mag schon sein, dass LORD VICAR bislang nicht den ganz großen Status erlangt haben und ihr Sound eher ein Nischendasein fristet. Die Songs auf „Fear no Pain“ sind strukturell weniger im klassischen Metal beheimatet, mitsingkompatible Refrains als prägende Stilmittel kommen hier nicht zum Tragen. Was die Platte dominiert, sind teils in Zeitlupe ausgewalzte, sich wiederholende monotone Riffs, die in angenehm organischem Gitarrensound den Stücken eine eigentümliche Dramaturgie verleihen. Etwas flottere Midtempo-Passagen oder akustische Teile finden sich allerdings auch, was die meist recht langen Songs (im Schnitt acht Minuten, selbst wenn man den 14minütigen Abschlusstrack weglässt) abwechslungsreicher macht.
 Vier Songs auf dem Album entstanden ursprünglich noch für
die im Gründungsjahr von LORD VICAR aufgelöste
Underground-Doom-Institution REVEREND BIZARRE, deren Gitarrist Kimi
Kärki das Material zu LORD VICAR mitnahm. Das auf „The Church Within
Records“ erschienene Album hat sich über zehn Jahre später gut
gehalten, war also keine hochgejubelte Eintagsfliege. Neueinsteiger im
Genre werden mit der Mischung aus REVEREND BIZARRE und COUNT RAVEN
bestens bedient, die Scheibe ist daher nicht nur den fortgeschrittenen
Doom-Kennern zu empfehlen.
Vier Songs auf dem Album entstanden ursprünglich noch für
die im Gründungsjahr von LORD VICAR aufgelöste
Underground-Doom-Institution REVEREND BIZARRE, deren Gitarrist Kimi
Kärki das Material zu LORD VICAR mitnahm. Das auf „The Church Within
Records“ erschienene Album hat sich über zehn Jahre später gut
gehalten, war also keine hochgejubelte Eintagsfliege. Neueinsteiger im
Genre werden mit der Mischung aus REVEREND BIZARRE und COUNT RAVEN
bestens bedient, die Scheibe ist daher nicht nur den fortgeschrittenen
Doom-Kennern zu empfehlen.
Kleinere Schönheitsfehler mag es geben, etwa den etwas wackeligen Gesang im Akustik-Intro des letzten Stücks „The Funeral Pyre“, was aber gar nicht so besonders störend ist. Schließlich steigert sich der Song schnell zu einem Doom-Glanzstück, bei dem als Gast auch Angelo Tringali (Gitarrist von The Lord Weird Slough Feg) zu hören ist. Mit simplen, aber doch wirkungsvollen Melodien geht „Fear no Pain“ mit hoher Formkurve durchs Ziel. Fazit: Nicht nur für ausgewiesene Experten ein hörenswertes Album!
- Stefan - 10/2020

 Vom Doom Metal heutiger Tage geht es zurück in die
Siebziger zu einem frühen Werk von Mike Oldfield, der nur wenige Jahre
zuvor mit seinem Debütalbum den großen Durchbruch geschafft hatte und
Musikfreunden mittleren Alters auch durch erfolgreiche Popsongs aus den
Achtzigern bekannt sein dürfte. „Ommadawn“ ist das dritte Studioalbum,
das über die Jahrzehnte in verschiedenen Mix-Versionen sowie um
zusätzliche Stücke ergänzten Varianten erschien, während die
ursprüngliche LP lediglich zwei lange, vielschichtig arrangierte Tracks
und einen kurzen Anhang („On Horseback“) unter anderen mit einem
Kinderchor enthielt.
Vom Doom Metal heutiger Tage geht es zurück in die
Siebziger zu einem frühen Werk von Mike Oldfield, der nur wenige Jahre
zuvor mit seinem Debütalbum den großen Durchbruch geschafft hatte und
Musikfreunden mittleren Alters auch durch erfolgreiche Popsongs aus den
Achtzigern bekannt sein dürfte. „Ommadawn“ ist das dritte Studioalbum,
das über die Jahrzehnte in verschiedenen Mix-Versionen sowie um
zusätzliche Stücke ergänzten Varianten erschien, während die
ursprüngliche LP lediglich zwei lange, vielschichtig arrangierte Tracks
und einen kurzen Anhang („On Horseback“) unter anderen mit einem
Kinderchor enthielt.
Oldfield wird mit diesem Album gerne neben seinen offensichtlichen
Folk-Wurzeln auch im Bereich der Weltmusik einsortiert, fanden sich
doch auch afrikanische Trommelelemente auf „Ommadawn“ wieder. Überhaupt
ist die stilistische Vielfalt in sich harmonisch und bleibt nicht auf
der Ebene eines Sammelsuriums stecken. Während die beiden titelgebenden
langen Stücke phasenweise dramatisch anschwellen (Teil 1) oder mit
ruhiger Gelassenheit dahinfließen (Titel 2), gesellen sich auch
verschiedene Folk-Abschnitte mit irischem Dudelsack und
Volkstanz-Rhythmen hinzu. Auch wenn Oldfield selbst eine lange Liste an
Instrumenten spielte, war die Zahl musikalischer Gäste, die auf
„Ommadawn“ mitwirkten, bemerkenswert. Das Kunststück dabei war, dass
sowohl Mike Oldfields charakteristische, unverwechselbare
Gitarrenarbeit und Kompositionstechnik zu ihrem Recht kamen wie auch
die Beiträge der Gastmusiker, ohne sich aber gegenseitig dominant zu
überlagern.
 Welcher der mittlerweile recht zahlreichen
Auflagen und Wiederveröffentlichungen man nun den Vorzug geben soll,
bleibt dem persönlichen Geschmack überlassen – Auswahl gibt es
jedenfalls reichlich. Puristen mögen vielleicht das Album in seiner
Ursprungsform bevorzugen, ist es doch mit seinen beiden ausgedehnten
Variationen des Titelstücks eine Reise durch verschiedene musikalische
Kulturformen und verbunden damit durch imaginäre Landschaften.
Welcher der mittlerweile recht zahlreichen
Auflagen und Wiederveröffentlichungen man nun den Vorzug geben soll,
bleibt dem persönlichen Geschmack überlassen – Auswahl gibt es
jedenfalls reichlich. Puristen mögen vielleicht das Album in seiner
Ursprungsform bevorzugen, ist es doch mit seinen beiden ausgedehnten
Variationen des Titelstücks eine Reise durch verschiedene musikalische
Kulturformen und verbunden damit durch imaginäre Landschaften.
In späteren Ausgaben kamen noch diverse Bonustracks hinzu, die
ebenfalls gelungen sind und die stilistische Linie der LP weiterführen.
Die beiden Stücke „Argiers“ (mit der Flöte als prägendem Instrument)
und „First Excursion“ (hier hat die Gitarre die Führungsrolle) sind mit
vier bzw. sechs Minuten allerdings vergleichsweise kurz geraten und
können nicht die epische Breite der beiden „Ommadawn“-Langtracks
entfalten. Ihre ebene Struktur ist auch ganz anders angelegt, da keine
stetig hinzutretenden neuen Elemente aufeinander geschichtet und
dadurch weiterentwickelt werden.
Volkstanz-Musik gibt’s in dem gerade mal zweiminütigen „Portsmouth“ zu
hören, einem heiteren und tanzbaren Stück, das ebenso wie „On
Horseback“ kein Fremdkörper ist und allenfalls musikalisch einen
Gegensatz zu den ausladenden und teilweise dramatisch-schweren
Abschnitten darstellt. Es dürfte Mike Oldfields persönlichem und
künstlerischem Empfinden entsprechen, diese nur scheinbaren
Widersprüche als Teil eines Ganzen zu sehen, in dem das Tiefgründige
und Melancholische eben nicht ohne das Leichte und Romantische
existiert, sondern beides als musikalische Einheit organisch
zusammengehört und auch so funktioniert.
- Stefan - 10/2020
 Kurz nach Halloween läge es natürlich nahe, in der
Herbstmusik mit dem von John Carpenter selbst komponierten Score zu
seinem Horrorklassiker von 1978 aufzuwarten, aber ganz so
offensichtlich müssen wir es ja nun auch nicht machen (wenngleich der
HALLOWEEN-Soundtrack sehr wohl seine beachtlichen Qualitäten hat).
Überhaupt sind die Soundtracks zu Carpenters Filmen speziell aus den
Siebzigern und frühen Achtzigern sehr bemerkenswert, da sie von der
Personalunion eines Regisseurs auf seinem kreativen Höhepunkt mit einem
ebenso begabten Musiker leben, der seine Vorstellungen nicht erst
langwierig einem Komponisten erklären muss, sondern seine eigenen
Bilder und Töne erschaffen kann.
Kurz nach Halloween läge es natürlich nahe, in der
Herbstmusik mit dem von John Carpenter selbst komponierten Score zu
seinem Horrorklassiker von 1978 aufzuwarten, aber ganz so
offensichtlich müssen wir es ja nun auch nicht machen (wenngleich der
HALLOWEEN-Soundtrack sehr wohl seine beachtlichen Qualitäten hat).
Überhaupt sind die Soundtracks zu Carpenters Filmen speziell aus den
Siebzigern und frühen Achtzigern sehr bemerkenswert, da sie von der
Personalunion eines Regisseurs auf seinem kreativen Höhepunkt mit einem
ebenso begabten Musiker leben, der seine Vorstellungen nicht erst
langwierig einem Komponisten erklären muss, sondern seine eigenen
Bilder und Töne erschaffen kann.
Der Score zu THE FOG - NEBEL DES GRAUENS lebt von den düster wabernden
Klängen (was natürlich sehr gut zur unheimlichen Nebelbank passt, die
sich auf das Küstenstädtchen Antonio Bay zubewegt), die mit einfachen,
wirkungsvollen Melodien ergänzt werden – wie gleich zu Beginn des Films
überaus gelungen zu erleben, wenn der alte Seebär den gebannt
zuhörenden Kindern eine gruselige Geschichte erzählt und die Kamera
danach für die Vorspannsequenz die nächtliche, von unheimlichem
Mondlicht erleuchtete Bucht erfasst. Je stärker an der
Spannungsschraube gedreht wird, umso mehr nimmt auch die Musik an
Eindringlichkeit zu – bestens nachzuhören im abschließenden Track „Reel
9“ (ganze elf Minuten lang). Das Einzige, was heutzutage etwas störend
ist, sind die Artworks diverser VÖs der jüngeren Vergangenheit, die
teilweise seltsam experimentell oder einfallslos (grün eingefärbte
Zombie-Piraten als Frontmotiv) daherkommen. Schöner gestaltet sind die
Auflagen aus den Achtzigern, speziell die im LP-Format (die CD
beschränkt sich auf einen Ausschnitt des eigentlichen Motivs).

 Ein Film ganz eigener Art, mit einem wirklich
unverwechselbaren Score, ist der einstmals indizierte, heute bei uns
jedoch ab 16 Jahren freigegebene VIDEODROME von David Cronenberg – sein
persönliches Meisterwerk, auch wenn die selbst erschaffene Konkurrenz
im eigenen Gesamtwerk natürlich auch einiges vorweisen kann. Die Story
im Schnelldurchgang: Max Renn (James Woods), der Betreiber eines
kleinen privaten TV-Senders in Toronto will mit reißerischen Inhalten
eine Marktlücke besetzen und das zeigen, was andere nicht bieten: Sex,
Gewalt und ähnlich kontroverses Material. Auf seiner Suche nach
wirklich Ungewöhnlichem stößt er auf ein verschlüsselt ausgestrahltes
Untergrund-Programm namens „Videodrome“ mit sehr realistischen Folter-
und Mordszenen. Im Grunde ohne Handlung, aber mit einer eigenartig
faszinierenden Wirkung. Was Renn schon bald herausfindet: „Videodrome“
ist kein Fake, sondern offensichtlich echt – und das Schlimmste folgt
erst noch. Das Programm lässt im Zuschauer einen Gehirntumor entstehen,
der wiederum grauenhafte Halluzinationen auslöst. Max Renn taumelt
einem Abgrund aus SM-Sex, Folter und Mord entgegen, in dem Realität und
Täuschung kaum mehr zu unterscheiden sind…
Ein Film ganz eigener Art, mit einem wirklich
unverwechselbaren Score, ist der einstmals indizierte, heute bei uns
jedoch ab 16 Jahren freigegebene VIDEODROME von David Cronenberg – sein
persönliches Meisterwerk, auch wenn die selbst erschaffene Konkurrenz
im eigenen Gesamtwerk natürlich auch einiges vorweisen kann. Die Story
im Schnelldurchgang: Max Renn (James Woods), der Betreiber eines
kleinen privaten TV-Senders in Toronto will mit reißerischen Inhalten
eine Marktlücke besetzen und das zeigen, was andere nicht bieten: Sex,
Gewalt und ähnlich kontroverses Material. Auf seiner Suche nach
wirklich Ungewöhnlichem stößt er auf ein verschlüsselt ausgestrahltes
Untergrund-Programm namens „Videodrome“ mit sehr realistischen Folter-
und Mordszenen. Im Grunde ohne Handlung, aber mit einer eigenartig
faszinierenden Wirkung. Was Renn schon bald herausfindet: „Videodrome“
ist kein Fake, sondern offensichtlich echt – und das Schlimmste folgt
erst noch. Das Programm lässt im Zuschauer einen Gehirntumor entstehen,
der wiederum grauenhafte Halluzinationen auslöst. Max Renn taumelt
einem Abgrund aus SM-Sex, Folter und Mord entgegen, in dem Realität und
Täuschung kaum mehr zu unterscheiden sind…
Ein auch nach Jahrzehnten niemals langweilig oder inhaltlich obsolet
werdender Film, da die Thematik stets aufs Neue zu intensiven
Denkprozessen anregt. Auch anachronistische Elemente wie Max Renns
Betamax-Videos, die ebenso wie VHS-Kassetten oder Laserdiscs längst zu
Exponaten für das Technikmuseum geworden sind, haben VIDEODROME nicht
unvorteilhaft altern lassen. Was im Film ein perverses Faszinosum wie
„Videodrome“ war, könnte heute das Internet sein, das in modernisierter
Weise neue Formen der Manipulation betreiben, bewusste Schäden
anrichten und soziale Strukturen zersetzen kann. Es sind auch hier
wieder die Nutzer selbst, die das destruktive Geschäft annehmen und es
durch ihren Konsum selbst weiterbetreiben.
Howard Shore, der musikalisch je nach Charakter des jeweiligen Films
eine große Bandbreite bedient, sei es der bisweilen anstrengende
Jazz-Score für NAKED LUNCH (ebenfalls von Cronenberg) oder die
Filmmusik für große Mainstream-Fantasy wie die DER HERR DER
RINGE-Trilogie, hat für VIDEODROME einen Soundtrack komponiert, der
eine vielschichtige Ausstrahlung besitzt: kühl, monoton, untergründig
und mit keinem anderen Filmscore verwechslungsgefährdet. Shore spielt
synthetisch-düstere Klänge, die wie aus dem Unterbewusstsein schöpfende
Konstrukte wirken. Die perfekte Klangkulisse für einen
außergewöhnlichen Film, die auch beinahe 40 Jahre später keine
Alterserscheinungen zeigt, weil sie schon damals keiner musikalischen
Dramaturgie nahestand, wodurch man sie heute in der Schublade „typisch
Achtziger“ einordnen könnte. So mancher wusste nur wenig damit
anzufangen, Monotonie war da noch ein harmloser Vorwurf. Andere dagegen
waren von Film wie Score gleichermaßen begeistert und sind es bis heute
geblieben. Auch wenn die CD aktuell leider neu nicht mehr zu bekommen
und gebraucht sehr teuer geworden ist: Die Anschaffung lohnt sich!
- Stefan- 11/2020

 Man muss kein religöser Mensch sein, wie der estnische
Komponist Arvo Pärt, um in "Spiegel im Spiegel" eine Ebene zu erahnen,
die tiefer liegt, als das, was das reduzierte Spiel von Klavier und
Violine darstellt - im Notenblatt wird der Schwiergkeitsgrad als "sehr
leicht" eingestuft. Das Stück kann aufgrund seiner Unaufdringlichkeit
gut als Hintergrundmusik laufen, hat aber beim bewussten Hören, vor
allem über Kopfhörer, eine erstaunlich fesselnde und zugleich
entspannende Wirkung. Als musikalischer Grundschüler würde ich sagen,
dass Arvo Pärt hier mit Dreiklängen weite innere Klangwelten erschafft,
ähnlich wie der Spiegel im Spiegel eine visuelle Unendlichkeit.
Man muss kein religöser Mensch sein, wie der estnische
Komponist Arvo Pärt, um in "Spiegel im Spiegel" eine Ebene zu erahnen,
die tiefer liegt, als das, was das reduzierte Spiel von Klavier und
Violine darstellt - im Notenblatt wird der Schwiergkeitsgrad als "sehr
leicht" eingestuft. Das Stück kann aufgrund seiner Unaufdringlichkeit
gut als Hintergrundmusik laufen, hat aber beim bewussten Hören, vor
allem über Kopfhörer, eine erstaunlich fesselnde und zugleich
entspannende Wirkung. Als musikalischer Grundschüler würde ich sagen,
dass Arvo Pärt hier mit Dreiklängen weite innere Klangwelten erschafft,
ähnlich wie der Spiegel im Spiegel eine visuelle Unendlichkeit.
"Spiegel im Spiegel" habe ich zufällig beim Hören eines amerikanischen Klassik-Podcasts entdeckt und dabei festgestellt, dass mir das Stück von irgendwoher bekannt vorkam, denn es wurde u. a. im Weltraumdrama "Gravity" verwendet. Das Stück kann zur "minimal music" gezählt werden, eine Richtung der "Neuen Musik", die ich gerade etwas zu entdecken beginne, aber eben nie als solche wahrgenommen habe. Stücke von z. B. Philip Glass finden sich oft in Soundtracks und lösen damit die aus Kulturdünkel gezogene Grenze zwischen sogenannter E- und U-Musik auf.
- Martin - 11/2020
 In einem Interview im aktuellen Rock Hard nennt
Lars Ulrich (soll ich da jetzt wirklich in Klammern „Metallica-Drummer“
schreiben, weil vielleicht jemand seinen Namen nicht zuordnen kann?)
Jazzmusik als Hilfsmittel zum Runterkommen nach Konzerten. Das kann man
auch in anderen Situationen gut gebrauchen, wenn immer mehr Menschen
dem Irrsinn zu verfallen scheinen, ein ultrahocherhitzter Wahlkampf in
den USA wieder mal eine gespaltene Nation hinterlässt und hierzulande
reihenweise vernunftabstinente Zeitgenossen in das Lager abstruser
Verschwörungserzählungen abwandern.
In einem Interview im aktuellen Rock Hard nennt
Lars Ulrich (soll ich da jetzt wirklich in Klammern „Metallica-Drummer“
schreiben, weil vielleicht jemand seinen Namen nicht zuordnen kann?)
Jazzmusik als Hilfsmittel zum Runterkommen nach Konzerten. Das kann man
auch in anderen Situationen gut gebrauchen, wenn immer mehr Menschen
dem Irrsinn zu verfallen scheinen, ein ultrahocherhitzter Wahlkampf in
den USA wieder mal eine gespaltene Nation hinterlässt und hierzulande
reihenweise vernunftabstinente Zeitgenossen in das Lager abstruser
Verschwörungserzählungen abwandern.
Jazzmusik also – bislang nicht gerade besonders präsent im ZWNN. Das
schwedische Esbjörn Svensson Trio soll die sechste Haltestelle in
unserer diesjährigen Herbstreihe sein. Es wurde benannt nach seinem im
Jahr 2008 bei einem Tauchunfall ums Leben gekommenen Bandleader, war
während seines Bestehens auf der Erfolgsleiter stetig nach oben
geklettert und in Deutschland nicht zuletzt dank der Aufzeichnungen
beim weltweit vielbeachteten Jazzfestival von Burghausen ziemlich
bekannt. ARD Alpha sendet regelmäßig am Sonntagabend seine beliebten
Mitschnitte von den „Jazzwochen“ und erreicht damit ein internationales
Publikum – unschwer zu erkennen auch an den vielsprachigen Kommentaren
und Lobeshymnen zu den beiden „E.S.T.“-Auftritten in Burghausen von
2001 und 2004, die auf YouTube zu finden sind.
 Wer wie ich kein ausgewiesener Kenner der
Materie ist, greift in solchen Fällen gerne zu einer mehr oder minder
gelungenen Compilation, mit deren Hilfe weitere Feldforschungen
eingeleitet werden können. „Retrospective“, erschienen im Jahr nach
Esbjörn Svenssons Unfalltod im Alter von gerade einmal 44 Jahren, ist
bis auf nur spärliche Ausflüge in etwas „wilderes“ Terrain eine
musikalisch entspannende und zugleich aber auch mitreißende
Angelegenheit, denn was das Trio hier in Sachen Musikalität auf
Tonträger gezaubert hat, ist schon beeindruckend. Weitab vom Klischee
des Jazz als verstaubter Unterhaltung für angegraute Oberstudienräte
und ohne das Gehabe eines elitären Zirkels sind die 75 Minuten auch für
Genre-Neulinge zu empfehlen, weil sie mit ihren Einflüssen aus anderen
Stilrichtungen den Einstieg erleichtern. Vom musikalischen Können des
Trios gar nicht zu reden, denn das spricht ohnehin für sich selbst.
Wer wie ich kein ausgewiesener Kenner der
Materie ist, greift in solchen Fällen gerne zu einer mehr oder minder
gelungenen Compilation, mit deren Hilfe weitere Feldforschungen
eingeleitet werden können. „Retrospective“, erschienen im Jahr nach
Esbjörn Svenssons Unfalltod im Alter von gerade einmal 44 Jahren, ist
bis auf nur spärliche Ausflüge in etwas „wilderes“ Terrain eine
musikalisch entspannende und zugleich aber auch mitreißende
Angelegenheit, denn was das Trio hier in Sachen Musikalität auf
Tonträger gezaubert hat, ist schon beeindruckend. Weitab vom Klischee
des Jazz als verstaubter Unterhaltung für angegraute Oberstudienräte
und ohne das Gehabe eines elitären Zirkels sind die 75 Minuten auch für
Genre-Neulinge zu empfehlen, weil sie mit ihren Einflüssen aus anderen
Stilrichtungen den Einstieg erleichtern. Vom musikalischen Können des
Trios gar nicht zu reden, denn das spricht ohnehin für sich selbst.
Bis auf wenige Ausnahmen wie das abschließende „Leucocyte“ mit seiner
nervösen, unruhigen Rhythmusstruktur ist das Material auf
„Retrospective“ für ungeübte Ohren nicht überfordernd. Das ist auch bei
den Konzertmitschnitten aus Burghausen zu beobachten: Da wird nicht
etwa das eigene Können demonstrativ zur Schau gestellt, sondern einfach
nur wie aus einem Guss musiziert. Wie sehr das Trio in seinen besten
Momenten ganz nah bei sich war und doch einen vielseitigen, für äußere
Einflüsse offenen Sound zu produzieren vermochte, müsste auch Hörer
überzeugen können, die weder Jazzfreunde noch selbst Musiker sind. Das
Esbjörn Svensson Trio war im besten Sinne anspruchsvoll und
publikumsfreundlich zugleich, auch wenn „Retrospective“ trotz seines
musikalischen Genussfaktors immer auch etwas traurig stimmt: Was hätte
da noch alles kommen können…
- Stefan - 11/2020
 Die Neubauten stürzen schon lange nicht mehr ein, bemängeln
manche und sie haben sogar ein wenig Recht damit, wenn sie die
zunehmende Abwesenheit von brachialem Getöse meinen. Nur war dieses
eigentlich nie bestimmend für den Kern des EN-Sounds, auch schon damals
in den Achtzigern nicht. Im 40. Jahr ihres Bestehens sind die Neubauten
zwar in ihren Klangstrukturen sehr zugänglich, böse Zungen schrecken
auch vor dem schlimmen Wort „Mainstream“ nicht zurück und unterstellen
sogar rein kommerzielle Motive, aber irrelevant ist die Band noch lange
nicht geworden, nur weil sie anders ist als früher.
Die Neubauten stürzen schon lange nicht mehr ein, bemängeln
manche und sie haben sogar ein wenig Recht damit, wenn sie die
zunehmende Abwesenheit von brachialem Getöse meinen. Nur war dieses
eigentlich nie bestimmend für den Kern des EN-Sounds, auch schon damals
in den Achtzigern nicht. Im 40. Jahr ihres Bestehens sind die Neubauten
zwar in ihren Klangstrukturen sehr zugänglich, böse Zungen schrecken
auch vor dem schlimmen Wort „Mainstream“ nicht zurück und unterstellen
sogar rein kommerzielle Motive, aber irrelevant ist die Band noch lange
nicht geworden, nur weil sie anders ist als früher.
„Alles in Allem“ ist deutlich geprägt von der Vergangenheit, im Detail
von der Geschichte Berlins, nimmt Bezug auf bestimmte Stadtviertel und
zeigt Verbindungslinien auf, die bis in die Gegenwart reichen und damit
zu den Personen im Gefüge der Neubauten. Vom Opener „Ten Grand Goldie“
(von Blixa Bargeld als „Rocker“ bezeichnet) und sehr spärlichen
Krachausflügen abgesehen, ist die Scheibe über ausgedehnte Strecken
sanft und ruhig. Wer über TV-Serien wie BABYLON BERLIN Geschmack an
Berliner Geschichte gefunden hat, der wird in einem Stück wie „Am
Landwehrkanal“ (dort wurde Anfang 1919 die Leiche der von einem
Freikorps-Soldaten ermordeten Rosa Luxemburg gefunden) ganz
offensichtliche Anknüpfungspunkte zur Vergangenheit entdecken, die über
das rein Historisch-Politische hinaus auch in anderen Songs auftauchen.
 Der bisweilen kontemplative Charakter des Albums steht den
Neubauten gut, sie sind ja auch als Personen längst über die einstigen
Exzesse als „Junge Wilde“ hinaus. Sie schöpfen ihre Kraft und
Intensität aus einprägsamen Songs wie „Seven Screws“ (da lässt die
Bass-Melodie Anklänge an das TWIN PEAKS-Thema entstehen), die den roten
Faden des Albums auf den Punkt bringen: „Ich gehe rückwärts in meinen
eigenen Spuren…“. Eine rein retrospektive oder sogar
melancholisch-jammerige Angelegenheit ist „Alles in Allem“ jedoch
keineswegs, sondern eher eine Gelegenheit, Bilanz zu ziehen,
rückschauend Vergangenes zu ordnen, um dann neu sortiert in der
Gegenwart weiterzugehen.
Der bisweilen kontemplative Charakter des Albums steht den
Neubauten gut, sie sind ja auch als Personen längst über die einstigen
Exzesse als „Junge Wilde“ hinaus. Sie schöpfen ihre Kraft und
Intensität aus einprägsamen Songs wie „Seven Screws“ (da lässt die
Bass-Melodie Anklänge an das TWIN PEAKS-Thema entstehen), die den roten
Faden des Albums auf den Punkt bringen: „Ich gehe rückwärts in meinen
eigenen Spuren…“. Eine rein retrospektive oder sogar
melancholisch-jammerige Angelegenheit ist „Alles in Allem“ jedoch
keineswegs, sondern eher eine Gelegenheit, Bilanz zu ziehen,
rückschauend Vergangenes zu ordnen, um dann neu sortiert in der
Gegenwart weiterzugehen.
Nicht alle Stücke sind so stark wie „Seven Screws“ oder der
fantastische Titeltrack, aber dennoch hat das Album eine Menge Substanz
zu bieten. Sicher, es ist keine Musik mehr, zu der man sich live aus
Versehen eine Schneise in die Stirn flext oder in krachgeschwängerter
Ekstase Bühnen anzündet, aber auch wenn die EN meinetwegen nun
endgültig „erwachsen“ oder „konservativ“ geworden sind – sie sind nach
wie vor eine Gruppe mit eigenem Charakter und einer unverwechselbaren
Handschrift, die es versteht, auch nach 40 Jahren noch interessante
Musik zu produzieren. Allein das ist mehr als so manch andere Band zu
leisten vermag und es geht weit darüber hinaus, was in den Anfangstagen
der Neubauten für die Zukunft zu ahnen gewesen wäre.
- Stefan - 11/2020

 Dass es im Dezember schneit, konnte ja keiner
ahnen. Aber so treffen wir eben ca. eine Woche früher auf der
Zielgeraden unserer alljährlichen Herbstmusik-Strecke ein. Diesmal
begleitet von den ungekrönten Königen des Drone-Gebrummels SUNN O)))
und den Japanern BORIS, die sich 2006 zum gemeinsamen Musizieren
einfanden. Ebenfalls zu Gast waren unter anderem Musiker von
SOUNDGARDEN und EARTH. Letztere dröhnten sich schon in den frühen
Neunzigern durch monotone Sounds, die später von SUNN O))) populär
gemacht wurden.
Dass es im Dezember schneit, konnte ja keiner
ahnen. Aber so treffen wir eben ca. eine Woche früher auf der
Zielgeraden unserer alljährlichen Herbstmusik-Strecke ein. Diesmal
begleitet von den ungekrönten Königen des Drone-Gebrummels SUNN O)))
und den Japanern BORIS, die sich 2006 zum gemeinsamen Musizieren
einfanden. Ebenfalls zu Gast waren unter anderem Musiker von
SOUNDGARDEN und EARTH. Letztere dröhnten sich schon in den frühen
Neunzigern durch monotone Sounds, die später von SUNN O))) populär
gemacht wurden.
Das ist natürlich recht verkürzt dargestellt, aber SUNN O))) (benannt nach den Verstärkern, die EARTH benutzten) gelangten zu einer beachtlichen Breitenwirkung, wenn man bedenkt, dass ihre extreme Musik kaum als besonders massenkompatibel konzipiert ist, auch nicht in den Genres des härteren Metal, der oft genug in sich ziemlich konservativ ist. Anklänge an konventionelle Rockmusik hat „Altar“ durch das Schlagzeug zu bieten, da dieses Element die Stücke doch etwas strukturierter erscheinen lässt, als wenn sie ausschließlich aus schier endlos dröhnenden Gitarrenwänden bestünden.
Doch dann ist da plötzlich mit „The Sinking Belle“ ein völlig anders instrumentiertes Stück mit Gesang, beinahe sanft und nicht so düster-bedrohlich wie SUNN O))) sonst zu Werke gehen. Der Song steht ihnen sehr gut zu Gesicht und sorgt auch für willkommene Abwechslung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Anhängerschaft der kultisch umschwärmten Truppe manche Elaborate insgeheim auf Dauer doch als etwas langatmig empfindet, aber weil man nicht als Banause dastellen will, markiert man natürlich vollkommene Ergriffenheit.

Auf „Altar“ funktioniert die Drone-Urgewalt auch durch die Zusammenarbeit mit Gastmusikern über die volle Albumdistanz, weil sich auf diese Weise einfach mehr Kontrastflächen ergeben, ohne dass der Musik deshalb gleich ihre Wirkung abhanden käme. In Tracks wie dem abschließenden, fast viertelstündigen „Blood Swamp“ herrscht genügend Finsternis, der es auch nicht an Intensität mangelt. Mit entsprechender Lautstärke mag das bei sensibleren Zeitgenossen gewisse Beklemmungen auslösen, was aber auch unter Beweis stellt, dass hier nicht einfach sinnlos durch die Gegend gedröhnt wird, sondern tatsächlich Musik stattfindet.
Wer auf das „Altar“-Gesamtpaket Wert legt, der wird auf die limitierten (also meist teueren) Doppel-CDs und Vinyl-Ausgaben ausweichen müssen, wobei gerade die LP-Varianten gerne mal deutlich jenseits der 50-Euro-Grenze angesiedelt sind. Was Sammler für den Besitz des Exklusiven ausgeben, das muss Normalsterblichen aber nicht als finanziell unerreichbar verwehrt bleiben. Für den kleinen Sparer, der die Wirtschaft am Laufen hält, ist auch eine gewöhnliche CD-Variante zu haben, die zwar ohne den 28-minütigen Bonustrack „Her Lips were wet with Venom“ auskommen muss, aber ansonsten die Anschaffung wert ist.
- Stefan - 12/2020