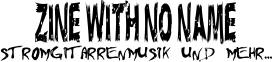

„The past is now part
of my future.
The present is
well out of hand.“
(Ian Curtis)
 Ein Spektrum von gleich mehreren
Stilrichtungen wird den Amerikanern ELDER zugeschrieben, wenn da von
einem Mix aus Heavy Psych, Stoner Rock und Progressive Metal die Rede
ist. Ja, Elemente daraus finden sich allesamt im Sound der Band aus
Massachusetts, wobei es auch eine Spur einfacher ginge: Wer mit einer
Band wie LONG DISTANCE CALLING etwas anfangen kann und sich nun auch
noch Gesang dazudenkt, der erhält eine gute Vorstellung davon, wohin
die Reise mit ELDER geht. Wobei die Sache mit dem Gesang in Fankreisen
keineswegs mit ungeteiltem Beifall aufgenommen wird, wie mir scheint.
Jedenfalls gab es da einiges an Kritik zu hören und manch einer hat
sich im Laufe der Jahre (die Band gibt es seit 2005) mittlerweile
verabschiedet.
Ein Spektrum von gleich mehreren
Stilrichtungen wird den Amerikanern ELDER zugeschrieben, wenn da von
einem Mix aus Heavy Psych, Stoner Rock und Progressive Metal die Rede
ist. Ja, Elemente daraus finden sich allesamt im Sound der Band aus
Massachusetts, wobei es auch eine Spur einfacher ginge: Wer mit einer
Band wie LONG DISTANCE CALLING etwas anfangen kann und sich nun auch
noch Gesang dazudenkt, der erhält eine gute Vorstellung davon, wohin
die Reise mit ELDER geht. Wobei die Sache mit dem Gesang in Fankreisen
keineswegs mit ungeteiltem Beifall aufgenommen wird, wie mir scheint.
Jedenfalls gab es da einiges an Kritik zu hören und manch einer hat
sich im Laufe der Jahre (die Band gibt es seit 2005) mittlerweile
verabschiedet.
Wobei die Gesangspassagen auf „Omens“ auch nicht so dominant sind, vor
allem mit Blick auf die Länge der fünf Tracks. Nur einer geht vor der
Zehn-Minuten-Marke durchs Ziel, die anderen liegen alle darüber.
Langweilig wird keiner davon, allerdings ist die ELDER-Musik keine, die
von einprägsamen Hooklines lebt, die einem nicht mehr aus dem Kopf
gehen wollen. Die Musiker schweifen gerne etwas ab, ohne sich aber im
Diffusen zu verlieren, da ist die Struktur der einzelnen Stücke noch
straff genug gehalten. „Omens“ ist eine jener postrockigen Scheiben,
die vom Fluss des Ganzen leben, nicht von Einzel-Highlights, denen
reines Füllmaterial gegenübersteht.
Was die Angelegenheit auflockert, sind diverse Keyboard-Passagen, über
die auch das Progressive-Rock-Element Eingang in die Musik findet.
Prägnanter und stärker wird die Platte aber in den Abschnitten, die
gitarrenlastiger ausgefallen sind und das ist über weite Strecken der
Fall. Angenehm fällt ebenfalls auf, dass die Band es versteht, sich
schön einzugrooven, wodurch auch zehn bis zwölf Minuten Spielzeit pro
Track nicht zu einer Geduldsprobe werden. Eine Ader für ausgedehnt
fließende Musik muss man natürlich schon mitbringen, das versteht sich
von selbst, und selbstredend haben ELDER das Genre auf „Omens“ nun auch
nicht komplett neu erfunden, was auch etwas schwierig ist (das Meiste
war halt schon in reichlicher Ausprägung einmal da).
Der verlinkte Session-Clip tönt phasenweise etwas ungeschliffener als
die Album-Version, diese ist im direkten Vergleich dafür kräftiger und
„kompletter“ produziert. Beide Varianten zeigen aber, was einen bei
ELDER so erwartet: gut gemachter Postrock mit Metal- und
Prog-Einflüssen, der gerade in dieser Jahreszeit angenehme Stimmungen
verbreitet – entschleunigend, aber kraftvoll genug, um noch als harter
Rock durchzugehen.
- Stefan - 10/2022
 Woher
die Abteilung „Stoner Rock“ kommt, in der das italienische Duo THE
PILGRIM unter anderem auch einsortiert wird, ist bei näherer
Betrachtung gar nicht so einfach zu erklären. Natürlich, die
psychedelische Schlagseite bei der Artwork-Gestaltung mag das
nahelegen, aber eigentlich geht’s hier um Folk Rock, der den Geist der
Sechziger atmet, der „Wüsten-Rock“ à la KYUSS und Konsorten ist
eigentlich der falsche Bezugspunkt (auch wenn die Musiker aus den
gleichen Quellen geschöpft haben mögen). Harte E-Gitarren werden bei
THE PILGRIM auch auf ihrem zweiten Album nicht eingesetzt. Es entspannt
wohltuend, musikalisch klar an vergangenen Zeiten orientiert, aber
nicht oberflächlich auf „retro“ gemacht.
Woher
die Abteilung „Stoner Rock“ kommt, in der das italienische Duo THE
PILGRIM unter anderem auch einsortiert wird, ist bei näherer
Betrachtung gar nicht so einfach zu erklären. Natürlich, die
psychedelische Schlagseite bei der Artwork-Gestaltung mag das
nahelegen, aber eigentlich geht’s hier um Folk Rock, der den Geist der
Sechziger atmet, der „Wüsten-Rock“ à la KYUSS und Konsorten ist
eigentlich der falsche Bezugspunkt (auch wenn die Musiker aus den
gleichen Quellen geschöpft haben mögen). Harte E-Gitarren werden bei
THE PILGRIM auch auf ihrem zweiten Album nicht eingesetzt. Es entspannt
wohltuend, musikalisch klar an vergangenen Zeiten orientiert, aber
nicht oberflächlich auf „retro“ gemacht.
Im Oktober 2020 veröffentlicht, passt „… from the Earth …“ hervorragend
in den Herbst. Wobei die Ruhe der Musik keinen schwermütigen Charakter
transportiert, eher eine in sich ruhende Leichtigkeit – nicht zu
verwechseln mit locker-flockiger Belanglosigkeit. Probleme des Alltags
(und davon haben wir ja gerade im Moment genug) lassen sich für 50
Minuten abstreifen, ohne dass hier abgedrehter Eskapismus stattfände.
Ein Klischee, das mit psychedelisch angehauchter Musik ja durchaus
verbunden wird – als sei dieser Sound ohne unterstützendes Kiffen nicht
zu denken.
 Ein
kleiner Kritikpunkt wäre die Geschlossenheit der Platte, die sich keine
besonderen stilistischen Auffälligkeiten leistet, keine herausragenden
Stücke, die man früher als potenzielle Hitsingle bezeichnet hätte. Zwei
oder drei von diesen wirklich griffigen Momenten hätte das Album
durchaus vertragen können, was aber der musikalischen Performance nicht
negativ angerechnet werden soll. THE PILGRIM haben sich hier ihren
eigenen Kosmos geschaffen, wo sie sich ganz der Stimmung hingeben, die
ihnen passend erscheint. In Sachen Songwriting ist noch Luft nach oben,
aber das sollte kein großes Problem darstellen (ein kurzes Intermezzo
wie der vorletzte Track „Space and Time“ zeigt da schon Möglichkeiten
auf). Nachdem bereits das erste Album sehr wohlwollend aufgenommen
worden war, sollte es THE PILGRIM auch in Zukunft nicht an
interessierten Zuhörern mangeln.
Ein
kleiner Kritikpunkt wäre die Geschlossenheit der Platte, die sich keine
besonderen stilistischen Auffälligkeiten leistet, keine herausragenden
Stücke, die man früher als potenzielle Hitsingle bezeichnet hätte. Zwei
oder drei von diesen wirklich griffigen Momenten hätte das Album
durchaus vertragen können, was aber der musikalischen Performance nicht
negativ angerechnet werden soll. THE PILGRIM haben sich hier ihren
eigenen Kosmos geschaffen, wo sie sich ganz der Stimmung hingeben, die
ihnen passend erscheint. In Sachen Songwriting ist noch Luft nach oben,
aber das sollte kein großes Problem darstellen (ein kurzes Intermezzo
wie der vorletzte Track „Space and Time“ zeigt da schon Möglichkeiten
auf). Nachdem bereits das erste Album sehr wohlwollend aufgenommen
worden war, sollte es THE PILGRIM auch in Zukunft nicht an
interessierten Zuhörern mangeln.
THE PILGRIM bei Bandcamp:
Obsessed by the West Part I, II, III, IV
Space and Time
- Stefan - 10/2022

 Auf drei Alben kommt die seit dem Jahr 2016 bestehende
Frauenband BLACKWATER HOLYLIGHT aus Portland im Nordwesten der USA
mittlerweile, wobei mir das vorliegende Debutalbum mit einem gewissen
(aber nicht übermäßig großen) Vorsprung gegenüber den beiden
Nachfolgern am besten gefällt. Die Stadt Portland war seit den frühen
Achtzigerjahren ein lebhaftes Zentrum der alternativen Rock-Szene, die
Bandbreite reichte von Elliot Smith bis Poison Idea. Der freiheitliche
Geist der Stadt (Näheres dazu einfach bei Wikipedia nachschlagen)
schlug sich also zweifelsohne auch im Kulturleben nieder. Schwer zu
sagen, ob das auch konkret den Sound der Damen von BLACKWATER HOLYLIGHT
beeinflusst hat, jedenfalls trägt die vorliegende Scheibe etwas
angenehm in sich Ruhendes.
Auf drei Alben kommt die seit dem Jahr 2016 bestehende
Frauenband BLACKWATER HOLYLIGHT aus Portland im Nordwesten der USA
mittlerweile, wobei mir das vorliegende Debutalbum mit einem gewissen
(aber nicht übermäßig großen) Vorsprung gegenüber den beiden
Nachfolgern am besten gefällt. Die Stadt Portland war seit den frühen
Achtzigerjahren ein lebhaftes Zentrum der alternativen Rock-Szene, die
Bandbreite reichte von Elliot Smith bis Poison Idea. Der freiheitliche
Geist der Stadt (Näheres dazu einfach bei Wikipedia nachschlagen)
schlug sich also zweifelsohne auch im Kulturleben nieder. Schwer zu
sagen, ob das auch konkret den Sound der Damen von BLACKWATER HOLYLIGHT
beeinflusst hat, jedenfalls trägt die vorliegende Scheibe etwas
angenehm in sich Ruhendes.
Böse
Zungen mögen vielleicht anmerken, dass es ihnen hier ein wenig zu
schrammelig-entspannt zugeht, aber genau das ist ja der Kern des
Ganzen. Aufs Gaspedal wird hier nicht getreten, die Musik pendelt
zwischen ruhigem Indie-Rock und doomigen Passagen. Auf den Folgealben
ist in Ansätzen etwas von dem zu hören, was eine Band wie JEX THOTH
auszeichnet, auf dem Debut klingen die Gitarren noch einen Tick
zurückhaltender. Was bei den Songstrukturen auffällt,  ist die fehlende Wucht bei an sich dafür ja
geeigneten Stellen oder sagen wir vielleicht: fehlende männliche
Kraftmeierei? Auch aufdringliches okkultures Gedöns, sonst im
Retro-Rock ja gern bemüht, lässt sich hier nicht ausmachen.
ist die fehlende Wucht bei an sich dafür ja
geeigneten Stellen oder sagen wir vielleicht: fehlende männliche
Kraftmeierei? Auch aufdringliches okkultures Gedöns, sonst im
Retro-Rock ja gern bemüht, lässt sich hier nicht ausmachen.
Was nun nicht heißen soll, dass hier Musik mit der Durchschlagskraft von lauwarmem Fencheltee durch die Boxen tönt. Die Band schafft es vielmehr, an bestimmten Stellen zumindest meine Erwartungshaltung ein wenig zu unterlaufen, ohne dabei völlig vom Weg abzuweichen. Das ist in der Summe keine überragend originelle Methode, aber keineswegs ungeschickt und daher interessant. Wer auf mitreißende Hooklines steht, wird auf dem Album nicht so richtig fündig werden, aber das schadet nicht. Denn mehrfach gehört offenbart dieses Debut eine Qualität, die mich an die Kolleg:innen (schreibt man das so?) von KINSKI aus Seattle erinnert, auch wenn die im Grundton doch härter und bei kürzeren Stücken zupackender waren. Im Vergleich dazu sind BLACKWATER HOLYLIGHT sowohl abschweifender wie auch gelassener, was ihnen aber gut zu Gesicht steht.
- Stefan -
10/2022
 Frauen am Klavier – wie geschaffen für
unsere Herbstmusik-Reihe? Da gibt es so einige hörenswerte
Künstlerinnen wie die Österreicherin Anja Plaschg (alias
„Soap&Skin“), die zu Beginn der 2010er-Jahre ihren Durchbruch
feiern konnte. Bei Agnes Obel waren es Film- und Serienproduktionen,
die ihre Musik transportierten und international bekannt machten. Ihr
zweites Album „Aventine“ ist nun auch schon fast wieder zehn Jahre alt
und konzentriert sich musikalisch fast zur Gänze auf Klavier und
Stimme, was einen eindringlichen Charakter hervorruft, der sich mit
größerer instrumentaler Opulenz versehen so wahrscheinlich nicht
eingestellt hätte.
Frauen am Klavier – wie geschaffen für
unsere Herbstmusik-Reihe? Da gibt es so einige hörenswerte
Künstlerinnen wie die Österreicherin Anja Plaschg (alias
„Soap&Skin“), die zu Beginn der 2010er-Jahre ihren Durchbruch
feiern konnte. Bei Agnes Obel waren es Film- und Serienproduktionen,
die ihre Musik transportierten und international bekannt machten. Ihr
zweites Album „Aventine“ ist nun auch schon fast wieder zehn Jahre alt
und konzentriert sich musikalisch fast zur Gänze auf Klavier und
Stimme, was einen eindringlichen Charakter hervorruft, der sich mit
größerer instrumentaler Opulenz versehen so wahrscheinlich nicht
eingestellt hätte.
Stilistisch gibt es eigentlich keine Ausreißer auf „Aventine“, was nicht als Nachteil zu verstehen ist. Stücke wie „Fuel to Fire“ (dazu spendierte David Lynch einen Remix) und „Dorian“ haben diese reduzierte, minimal wirkende Eleganz, in der nichts Spektakuläres geschieht, und die doch im Gedächtnis haften bleibt. Gelegentlich ertappt man sich bei dem Gedanken, dass die Platte kompositorisch vielleicht doch ein wenig gleichförmig strukturiert sein mag, aber dann packen einen diese einfachen und zugleich effektiven Melodien wie in „The Curse“, ohne dass viel passieren muss. Songs wie dieser schlagen auch im Zuhörer genau die richtigen Tasten an und wirken lange nach.
 Es sind die kleinen und in ihrer
Ausstrahlung doch großen musikalischen Gesten, die „Aventine“
bestimmen. Deren Qualität spiegelt sich auch in instrumentalen Stücken
wie „Fivefold“ wider, die ohne Agnes’ Stimme ebenso gut funktionieren.
Für die traurigen und melancholischen Momente im Leben ist diese Musik
wie geschaffen, weil diese dadurch (so sehen das offenbar auch nicht
wenige Kommentare unter den YouTube-Videos) greifbarer und erträglicher
werden. Man muss nicht gleich von therapeutischer Musik sprechen, aber
sie hat schon etwas angenehm Beruhigendes, ohne dabei in seichtes
Geplänkel zu verfallen. Nur zu empfehlen!
Es sind die kleinen und in ihrer
Ausstrahlung doch großen musikalischen Gesten, die „Aventine“
bestimmen. Deren Qualität spiegelt sich auch in instrumentalen Stücken
wie „Fivefold“ wider, die ohne Agnes’ Stimme ebenso gut funktionieren.
Für die traurigen und melancholischen Momente im Leben ist diese Musik
wie geschaffen, weil diese dadurch (so sehen das offenbar auch nicht
wenige Kommentare unter den YouTube-Videos) greifbarer und erträglicher
werden. Man muss nicht gleich von therapeutischer Musik sprechen, aber
sie hat schon etwas angenehm Beruhigendes, ohne dabei in seichtes
Geplänkel zu verfallen. Nur zu empfehlen!
- Stefan - 10/2022

 Ein eher in Vergessenheit geratenes Album aus
den frühen Achtzigern, als sich im Bereich Post-Punk, New Wave und
Gothic höchst Interessantes ereignete, das bis heute unbestreitbaren
Einfluss ausübt: „Fiction Tales“ von MODERN EON blieb der einzige
Longplayer der in den späten Siebzigern gegründeten Band, die es
daneben noch auf einige Singles brachte. Ein zweites Album war offenbar
schon im Entstehen begriffen, einige Demos entstanden, aber zu einem
LP-Release kam es nicht mehr.
Ein eher in Vergessenheit geratenes Album aus
den frühen Achtzigern, als sich im Bereich Post-Punk, New Wave und
Gothic höchst Interessantes ereignete, das bis heute unbestreitbaren
Einfluss ausübt: „Fiction Tales“ von MODERN EON blieb der einzige
Longplayer der in den späten Siebzigern gegründeten Band, die es
daneben noch auf einige Singles brachte. Ein zweites Album war offenbar
schon im Entstehen begriffen, einige Demos entstanden, aber zu einem
LP-Release kam es nicht mehr.
Die Band löste sich dann auf und verteilte sich auf andere Gruppen, von
denen DEAD OR ALIVE die bekannteste gewesen sein dürfte. Die hatten mit
ME-Gitarrist Tim Lever, der hier an die Keyboards wechselte, im Jahr
1985 einen großen Hit mit „You spin me round (like a Record)“, der auf
(gefühlt) mindestens 1000 Achtziger-Compilations auftauchen dürfte. Ein
Erfolg dieser Größenordnung war MODERN EON nicht ansatzweise vergönnt,
dafür war ihr einziges Album musikalisch vielleicht auch nicht
eingängig genug, was die Auflösung beschleunigt haben könnte.
MODERN EON waren stilistisch auf „Fiction Tales“ ein wenig zwischen den
Stühlen gelandet: nicht hart und düster genug, um sich mit Bands wie
JOY DIVISON messen zu können, auf der anderen Seite nicht mit dem
zwingenden Pop-Appeal von Zeitgenossen wie THE CURE ausgestattet, der
es ihnen ermöglich hätte, den Schritt zu Hitverdächtigem machen zu
können. Was einerseits bedeutet, dass wir es mit einer unausgegorenen
Platte zu tun haben, die aber wirklich gute Momente hat – der beste
sicherlich das als Single ausgekoppelte Stück „Child’s Play“ (das hätte
mit etwas Glück sehr wohl ein Hit werden können). Eine gelungene
Ergänzung ist auch die Peel Session vom Januar 1981, die man bei einer
Neuauflage definitiv mit an Bord nehmen sollte.
 Andere Tracks sind nicht so eingängig, haben einen etwas
sperrigen Charakter, der sich aber bei häufigerem Hören als kein allzu
großes Hindernis entpuppt. Kompositorisch wäre hier schon mehr drin
gewesen, der letzte Feinschliff scheint gelegentlich zu fehlen und auch
einige Gesangslinien wirken etwas uninspiriert. Das klingt vielleicht
ein wenig negativ, aber für Fans dieser Ära, die sich jenseits der
großen Namen gerne auch im Underground aufhalten und auf die Suche nach
Bands aus der zweiten Reihe gehen, ist „Fiction Tales“ durchaus ein
Antesten wert. Die erhältlichen CDs (dürften gebrannte Scheiben sein)
sind wohl nicht lizenziert, sodass man auf alte LPs ausweichen muss,
wenn es Legales sein soll. Fazit: kein großer Klassiker, aber solide
Arbeit. Genreliebhaber können reinhören!
Andere Tracks sind nicht so eingängig, haben einen etwas
sperrigen Charakter, der sich aber bei häufigerem Hören als kein allzu
großes Hindernis entpuppt. Kompositorisch wäre hier schon mehr drin
gewesen, der letzte Feinschliff scheint gelegentlich zu fehlen und auch
einige Gesangslinien wirken etwas uninspiriert. Das klingt vielleicht
ein wenig negativ, aber für Fans dieser Ära, die sich jenseits der
großen Namen gerne auch im Underground aufhalten und auf die Suche nach
Bands aus der zweiten Reihe gehen, ist „Fiction Tales“ durchaus ein
Antesten wert. Die erhältlichen CDs (dürften gebrannte Scheiben sein)
sind wohl nicht lizenziert, sodass man auf alte LPs ausweichen muss,
wenn es Legales sein soll. Fazit: kein großer Klassiker, aber solide
Arbeit. Genreliebhaber können reinhören!
- Stefan - 11/2022
 Es mag ein Irrtum sein,
aber irgendwie kommt es mir so vor, als stünden ECHO & THE BUNNYMEN
im Schatten wirklich groß gewordener Zeitgenossen wie THE CURE oder (in
allerdings kleinerem Maßstab) THE SMITHS oder SIOUXSIE AND THE
BANSHEES. Hört man dann noch ein Album wie „Ocean Rain“, ist wohl eine
kleine Korrektur fällig. Schon beim zweiten Stück „Nocturnal Me“,
perfekt ausbalanciert mit Indie-Weltschmerz und Streicher-Pathos,
möchte man schon die Höchstnote vergeben, doch lieber mal Vorsicht:
Noch ist kein Drittel der LP vergangen, noch sollte keine vorschnelle
Begeisterung ausbrechen.
Es mag ein Irrtum sein,
aber irgendwie kommt es mir so vor, als stünden ECHO & THE BUNNYMEN
im Schatten wirklich groß gewordener Zeitgenossen wie THE CURE oder (in
allerdings kleinerem Maßstab) THE SMITHS oder SIOUXSIE AND THE
BANSHEES. Hört man dann noch ein Album wie „Ocean Rain“, ist wohl eine
kleine Korrektur fällig. Schon beim zweiten Stück „Nocturnal Me“,
perfekt ausbalanciert mit Indie-Weltschmerz und Streicher-Pathos,
möchte man schon die Höchstnote vergeben, doch lieber mal Vorsicht:
Noch ist kein Drittel der LP vergangen, noch sollte keine vorschnelle
Begeisterung ausbrechen.
Auch wenn nicht jedes der folgenden Stücke ein Knaller auf vergleichbarem Niveau sein kann, sinkt das Gesamtniveau nicht merklich. „Ocean Rain“ war im Jahr 1984 bereits der fünfte Longplayer einer hörbar gereiften Band, die hier eingängiges und auch sperrigeres Material zu einer überzeugenden Mischung verbindet. Zwar ist „Thorn of Crowns“ ein kleiner Durchhänger, was jedoch kaum negativ aufzufallen vermag, denn gleich danach folgt mit „The Killing Moon“ einer der musikalischen Höhepunkte der gesamten Achtzigerjahre.
Liest man die YouTube-Kommentare unter dem Clip, sind diese voll von bittersüßen Anekdoten, von eigentlich längst vergangenem und doch in der Erinnerung noch präsentem Liebeskummer, von Erinnerungen an viel zu früh verstorbene Mitmenschen. Bei einigen dieser Momente wird es teilweise richtig tragisch („My husband bought this on 12" vinyl. He has alzheimer's and he cannot remember it at all. I love it now, even more. It breaks my heart he can't remember.”) und man kann es nachfühlen, dass hier keine überbordende Achtziger-Nostalgie am Werk war, sondern dieser Song tatsächlich etwas Tröstendes zu besitzen scheint.
Bei einer derart großen Hymne an die Traurigkeit ist es natürlich nicht einfach, das letzte Drittel des Albums auf ähnlichem Niveau ins Ziel zu bringen. Abgesehen von zwei eher improvisiert anmutenden Gitarrensoli in „My Kingdom“, die nicht so ganz gelungen wirken, hält sich die Band aber mehr als ordentlich: „Seven Seas“ und der abschließende Titeltrack können einiges, auch wenn es im Nachgang von „The Killing Moon“ noch einmal einer ähnlichen Glanzleistung bedurft hätte, aber wer schüttelt sich schon einen solchen Song mal einfach so aus dem Ärmel? Für die Platte spricht, dass eine Ausnahmenummer wie diese trotzdem nicht einfach den gesamten Rest zum Statistendasein verdammt. Eine reife Leistung, die Respekt verdient.
- Stefan 11/2022 -

 Wer
den deutschen Elektronik-Sound der Siebzigerjahre im Stil von TANGERINE
DREAM oder Klaus Schulze intensiver verfolgt hat, wird festgestellt
haben, dass diese Klänge international so einiges an Spuren
hinterlassen haben. Vielleicht nicht im Ausmaß eines Welterfolgs, wie
er sich bei KRAFTWERK einstellte, aber einflussreich waren auch deren
Kollegen zweifelsohne. Nachzuhören ist das etwa auf dem Debütalbum des
2004 verstorbenen Amerikaners Michael Garrison, der dank des WDR und
eines deutschen Lizenzdeals auch hierzulande seine Fanbase hatte.
Wer
den deutschen Elektronik-Sound der Siebzigerjahre im Stil von TANGERINE
DREAM oder Klaus Schulze intensiver verfolgt hat, wird festgestellt
haben, dass diese Klänge international so einiges an Spuren
hinterlassen haben. Vielleicht nicht im Ausmaß eines Welterfolgs, wie
er sich bei KRAFTWERK einstellte, aber einflussreich waren auch deren
Kollegen zweifelsohne. Nachzuhören ist das etwa auf dem Debütalbum des
2004 verstorbenen Amerikaners Michael Garrison, der dank des WDR und
eines deutschen Lizenzdeals auch hierzulande seine Fanbase hatte.
Aufgenommen 1978 und dann im Folgejahr veröffentlicht, nahm Garrisons
Erstling zunächst langsam Fahrt auf, er verkaufte das Album zu Beginn
sogar buchstäblich in Eigenregie. Dann jedoch traten Vertriebsfirmen an
ihn heran, auch für Deutschland, und Garrisons Name wurde bekannter.
Heute mag er wohl nur mehr jenen geläufig sein, die über das Studium
der musikalischen Vorbilder auch auf deren Nachfolger gestoßen sind,
aber es lohnt sich definitiv, hier einmal etwas genauer hinzuhören.
Das einfach wirkende, aber in seiner Schlichtheit effektive Albumcover
mit einem rot einfärbten Fotomotiv (auf der ersten Variante im
Eigenvertrieb nicht enthalten) regt die Fantasie zum Eintauchen in
Michael Garrisons musikalischen Kosmos an, der wohl von der Berliner
Schule der Siebziger inspiriert war. Ohne allerdings zum banalen
Epigonen zu werden, denn eine eigene Handschrift ist hier klar
erkennbar. Zwar erreicht die Musik nicht immer das Plateau der
namhaften Größen im Genre, doch Garrisons warme, eingängige
Synthie-Klänge haben gerade auf den ersten beiden Alben eine
bemerkenswerte Qualität, die bei besonders gelungenen Stücken wie „The
Voyage“ weitaus mehr als nur Genre-Standard bieten kann.
 Wer
sich für die Scheibe interessiert, dürfte ohne allzu große Probleme
fündig werden können, gab es doch in den Neunzigerjahren Neuauflagen
auf CD. Allerdings in leicht erweiterter Form, zum Teil auch mit zwei
Vocal-Tracks, die auf den alten, komplett instrumental gehaltenen
Vinyl-Ausgaben nicht enthalten waren. Diese Reissues tragen den Titel
„In the Regions of Sunreturn and beyond” und sind auch bei Cue Records
erhältlich, einem Vertrieb für elektronische Musik, der zu moderaten
Preisen so ziemlich das gesamte Werk von Michael Garrison im Programm
haben dürfte. Die alten Vinylscheiben sind über allseits bekannte
Plattformen wie Discogs oder Ebay ebenfalls gut auffindbar, ohne dass
völlig überzogene Mondpreise zu löhnen wären.
Wer
sich für die Scheibe interessiert, dürfte ohne allzu große Probleme
fündig werden können, gab es doch in den Neunzigerjahren Neuauflagen
auf CD. Allerdings in leicht erweiterter Form, zum Teil auch mit zwei
Vocal-Tracks, die auf den alten, komplett instrumental gehaltenen
Vinyl-Ausgaben nicht enthalten waren. Diese Reissues tragen den Titel
„In the Regions of Sunreturn and beyond” und sind auch bei Cue Records
erhältlich, einem Vertrieb für elektronische Musik, der zu moderaten
Preisen so ziemlich das gesamte Werk von Michael Garrison im Programm
haben dürfte. Die alten Vinylscheiben sind über allseits bekannte
Plattformen wie Discogs oder Ebay ebenfalls gut auffindbar, ohne dass
völlig überzogene Mondpreise zu löhnen wären.
-Stefan - 11/2022
 Ich gestehe, dass ich PJ
Harvey erst dieses Jahr so richtig entdeckt habe, nach dreißig Jahren
Ignoranz, zuerst wohl aufgrund "fehlender Härte" (persönlicher state of
mind bis Mitte der 90er), dann, weil sie trotz erweitertem
Musikgeschmacks in meiner "Blase", die damals noch nicht "Blase"
genannt wurde, nicht vorkam. Und leicht zugänglich war sie ja nie. Ich
erinnere mich, dass Mitstudentinnen total auf "Dry" (1992) und "Rid Of
Me" (1993) abfuhren, welche man grob dem feministischen
Riot-Girl-Flügel der damaligen Independent-Szene zuordnen konnte.
Rückblickend muss man feststellen, dass PJ Harvey in den 90ern
musikalisch so viel interessanter war, als viele der Bands, die es dann
bald nicht mehr gab. Unter anderem lag das sicher daran, dass ihre
Einflüsse breiter aufgestellt waren, z. B. aus dem Blues, was
nicht sofort offensichtlich ist, weil die Kombination nicht unbedingt
naheliegt.
Ich gestehe, dass ich PJ
Harvey erst dieses Jahr so richtig entdeckt habe, nach dreißig Jahren
Ignoranz, zuerst wohl aufgrund "fehlender Härte" (persönlicher state of
mind bis Mitte der 90er), dann, weil sie trotz erweitertem
Musikgeschmacks in meiner "Blase", die damals noch nicht "Blase"
genannt wurde, nicht vorkam. Und leicht zugänglich war sie ja nie. Ich
erinnere mich, dass Mitstudentinnen total auf "Dry" (1992) und "Rid Of
Me" (1993) abfuhren, welche man grob dem feministischen
Riot-Girl-Flügel der damaligen Independent-Szene zuordnen konnte.
Rückblickend muss man feststellen, dass PJ Harvey in den 90ern
musikalisch so viel interessanter war, als viele der Bands, die es dann
bald nicht mehr gab. Unter anderem lag das sicher daran, dass ihre
Einflüsse breiter aufgestellt waren, z. B. aus dem Blues, was
nicht sofort offensichtlich ist, weil die Kombination nicht unbedingt
naheliegt.
In 30 Jahren hat PJ Harvey neun reguläre Studio-Alben veröffentlicht,
arbeitete mit diversen anderen Künstlern wie Nick Cave oder Marianne
Faithfull zusammen und schrieb Soundtracks für Fernsehserien. Keines
der Alben klingt wie der Vorgänger (von der ersten beiden vielleicht
abgesehen), auch optisch veränderte sie sich im Lauf der Jahre,
manchmal auf provokante oder verstörende Weise. Was allen Werken jedoch
gemein ist, ist radikale Selbstoffenbarung, vor allem in der ersten
Jahren in sexueller Hinsicht, immer auch in der künstlerischen
Verarbeitung von persönlich erlebtem oder fiktivem psychischem Schmerz.
"White Chalk" ist das "Frau am Klavier"-Album von PJ Harvey, aber im
Gegensatz zu Agnes Obel war das Klavier nicht das Instrument, mit dem
sie sich bis dahin ausdrückte, tatsächlich empfand sie das Erlernen
eines neuen Instruments als Befreiung ihrer Vorstellungskraft. Zudem
ist die klassische Instumentierung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug
vorhanden, außerdem kommt eine Zither, die Mundharmonika und die Cig
Fiddle (eine Art Gitarre, die aus eine Zigarrenkiste gebaut wird) zu
Einsatz. In den letzten Jahren hat PJ Harvey auch die Demos ihrer Alben
veröffentlicht, und auf dem von "White Chalk" ist gut zu hören, wie die
Stücke zuerst am Klavier entworfen wurden.
Das Cover lässt vermuten, wohin die Reise gehen wird. Mit weißem
Kleid, im Stil einer von den Umständen ihrer Zeit gebeutelten jungen
Frau aus dem viktoriansichen England, blickt uns PJ Harvey ausdruckslos
mit im Schoß gefalteten Händen entgegen.
 Sie singt auf "White Chalk" höher als sonst, wie durch
Nebel oder wie
"when under ether" (einer der Songtitel). Hoffnung schlägt in Trauer um
("Silence") oder sie verleiht dem Kummer um die verstorbene Großmutter
Ausdruck ("To Talk To You"). Das Album endet mit "The Mountain"
konsequent mit langen Klageschrei.
Sie singt auf "White Chalk" höher als sonst, wie durch
Nebel oder wie
"when under ether" (einer der Songtitel). Hoffnung schlägt in Trauer um
("Silence") oder sie verleiht dem Kummer um die verstorbene Großmutter
Ausdruck ("To Talk To You"). Das Album endet mit "The Mountain"
konsequent mit langen Klageschrei.
Das muss man aushalten können, denn Erlösung gibt es hier nicht. Wie es
in der Besprechung auf pitchfork.com passend heißt "at the wrong time, in the wrong frame of
mind, 'White Chalk' may be the longest half-hour in the world".
"Sommerliche" Alben gibt es von PJ Harvey nicht, diese hier ist ihr
herbstlichstes, wenn nicht gar schon spätnovemberlichstes, wenn das
letzte Blatt vom Baum geweht wurde.
"White Chalk" sei also nicht als Einstieg in die Welt von PJ Harvey
empfohlen, außer man ist der richtigen, gefestigt melancholischen
Stimmung dazu. Die Intimität von "White Chalk" wird im Kontext des
Gesamtwerks erträglich und bereichernd, es liegt auch etwa in der Mitte
von "Rid Of Me" (1993) (mit der unglaublichen in-your-face-Produktion
von Steve Albini) und dem bislang letzten Album "The Hope Six
Demolition Project" (2016) - für 2023 ist ein neues Album angekündigt.
- Martin - 11/2022

 Es hat ja schon ein wenig Tradition in unserer
Herbstmusik-Rubrik, dass als Rausschmeißer gerne auch mal was
Fies-Finsteres erklingt. In diesem Jahr sollen es vier Songs einer
US-Kapelle sein, die wenig später zur deutlich bekannteren
Stoner/Doom-Band SLEEP wurde, die 1992 ihr Debüt auf Earache
herausbrachte. ASBESTOSDEATH waren damals eher kurzlebig unterwegs und
brachten es 1990 auf zwei Singles, die später auf Southern Lord als
Compilation wiederveröffentlicht wurden.
Es hat ja schon ein wenig Tradition in unserer
Herbstmusik-Rubrik, dass als Rausschmeißer gerne auch mal was
Fies-Finsteres erklingt. In diesem Jahr sollen es vier Songs einer
US-Kapelle sein, die wenig später zur deutlich bekannteren
Stoner/Doom-Band SLEEP wurde, die 1992 ihr Debüt auf Earache
herausbrachte. ASBESTOSDEATH waren damals eher kurzlebig unterwegs und
brachten es 1990 auf zwei Singles, die später auf Southern Lord als
Compilation wiederveröffentlicht wurden.
Musikalisch ist das Ganze durchaus mit SLEEP vergleichbar,
allerdings tönt der Sound hier weniger bekifft-abgedreht, sondern
kälter und abweisender. Die Basis liefert riffbetonter Doom, doch mit
klassischer Metal-Attitüde hat die Musik auf den beiden EPs nicht sehr
viel zu tun – also kein feierlicher Doom-Metal im Stil alter
Achtziger-CANDLEMASS, sondern eher eine Annäherung an eine
„Anti-Rock“-artige Herangehensweise, wenngleich ASBESTOSDEATH klar
hörbar auch eine unbestreitbare Verbeugung vor klassischen
Sabbath-Doom-Riffs in sich trugen.
 Das macht im Ergebnis eine ziemlich gute Mischung aus
schrägeren Doom-Abwandlungen und einem Gesang, wie er damals auch bei
Gruppen wie EYEHATEGOD bereits praktiziert wurde. Die vier Songs der
beiden EPs sind allerdings nicht so wuchtig-brutal, sie haben auch ein
paar Momente, die ruhig und gelassen sein wollen, bis dann der
noisig-verweifelte Doom-Blues wieder aus den Stücken herausbricht.
Musikalisch gefällt mir das in der Rückschau doch ziemlich gut, auch
wenn ich die Band gar nicht mehr so besonders auf dem Schirm hatte. Mag
auch daran liegen, dass die nachträglich veröffentlichte Compilation
halt nur 20 Minuten an Musik durch die Ziellinie bringt, was schade
ist. Da muss es doch mehr Material geben, möchte man meinen – seien es
Rehearsals oder Liveaufnahmen in präsentabler Qualität. Eine Neuauflage
mit einigen Zugaben sollte ihr Publikum finden, die Zielgruppe für
diesen schrägen Doom ist ja noch keineswegs ausgestorben.
Das macht im Ergebnis eine ziemlich gute Mischung aus
schrägeren Doom-Abwandlungen und einem Gesang, wie er damals auch bei
Gruppen wie EYEHATEGOD bereits praktiziert wurde. Die vier Songs der
beiden EPs sind allerdings nicht so wuchtig-brutal, sie haben auch ein
paar Momente, die ruhig und gelassen sein wollen, bis dann der
noisig-verweifelte Doom-Blues wieder aus den Stücken herausbricht.
Musikalisch gefällt mir das in der Rückschau doch ziemlich gut, auch
wenn ich die Band gar nicht mehr so besonders auf dem Schirm hatte. Mag
auch daran liegen, dass die nachträglich veröffentlichte Compilation
halt nur 20 Minuten an Musik durch die Ziellinie bringt, was schade
ist. Da muss es doch mehr Material geben, möchte man meinen – seien es
Rehearsals oder Liveaufnahmen in präsentabler Qualität. Eine Neuauflage
mit einigen Zugaben sollte ihr Publikum finden, die Zielgruppe für
diesen schrägen Doom ist ja noch keineswegs ausgestorben.
-Stefan - 12/2022